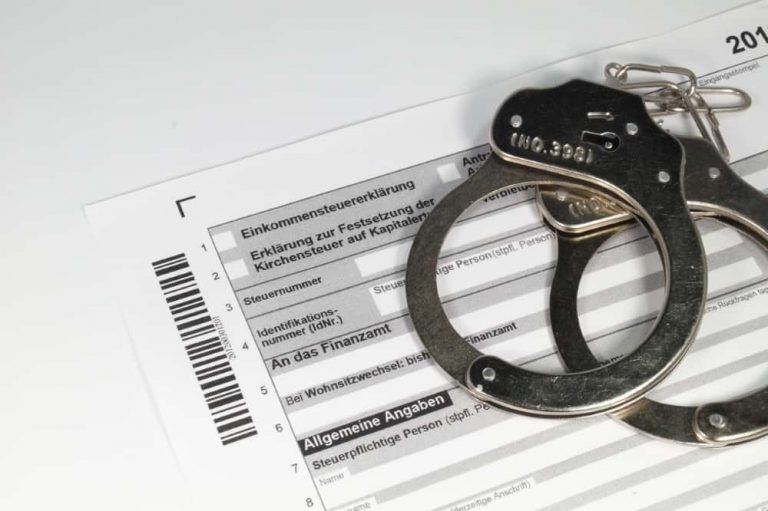Was ist eine strafbefreiende Selbstanzeige?
Eine strafbefreiende Selbstanzeige macht es möglich, trotz einer bereits begangenen oder auch nur versuchten Steuerstraftat einer Bestrafung zu entgehen. Wer seinem Finanzamt aus freien Stücken mitteilt, Steuern nicht vollständig bezahlt zu haben, geht unter Umständen straffrei aus. Eine Selbstanzeige muss allerdings sehr gut vorbereitet werden: Erstens sind bestimmte Voraussetzungen zu beachten und zweitens können Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder Unwissen die Straffreiheit gefährden.
- Wann hinterzieht man Steuern?
- Wer kann die Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung nutzen?
- Erlangt man durch eine Selbstanzeige automatisch Straffreiheit?
- Was bedeutet eine Strafanzeige für den Steuerberater?
- Wann ist eine Selbstanzeige beim Finanzamt nicht mehr möglich?
- Wie macht man eine Selbstanzeige bezüglich Steuerhinterziehung?
- Wann verjährt Steuerhinterziehung?
- Fazit
Die Steuerhinterziehung in Deutschland ist ein Zentraldelikt im Steuerstrafrecht. Um Steuerhinterziehung nach § 370 AO handelt es sich, wenn ein Steuerpflichtiger vorsätzlich unrichtige, unvollständige oder gar keine Angaben zu steuerlich wichtigen Sachverhalten gemacht hat. Das bewusste Verhalten muss dabei zu einer Steuerverkürzung oder einer ungerechtfertigten Vorteilserlangung geführt haben. Wann dabei eine Selbstanzeige zur Strafbefreiung möglich ist und was Sie sonst noch zum Thema wissen sollten, lesen Sie im Folgenden auf Steuer-Berater.de.
_____________________
Wir können keine Verantwortung für die Informationen übernehmen. Der Beitrag ist keine Rechtsberatung und kann auch keine Rechtsberatung ersetzen!
_____________________
Wann hinterzieht man Steuern?
- den Finanzbehörden oder anderen Behörden über steuerlich erhebliche Tatsachen unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
- die Finanzbehörden pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt oder
- pflichtwidrig die Verwendung von Steuerzeichen oder Steuerstemplern unterlässt
und dadurch Steuern verkürzt oder für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt.
Im Gegensatz zur Steuerverkürzung, bei der es sich lediglich um eine Ordnungswidrigkeit handelt, ist bei Steuerhinterziehung eine Ahndung zwingend erforderlich. Hier gilt das Legalitätsprinzip. Dieses besagt, dass eine die Strafverfolgungsbehörde (Staatsanwaltschaft, Polizei und Steuerfahndung), verpflichtet ist, ein Ermittlungsverfahren zu eröffnen, wenn sie Kenntnis von einer (möglichen) Straftat erlangt hat. Liegt hingegen lediglich eine leichtfertige Steuerverkürzung vor, liegt es im Ermessen der zuständigen Finanzbehörde, über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Aufgrund des Opportunitätsprinzips kann von einer weiteren Verfolgung abgesehen werden. Das Opportunitäts- oder Entschließungsprinzip erlaubt juristische Handlungsfreiheit innerhalb eines gesteckten rechtlichen Rahmens.
Bei einer Steuerordnungswidrigkeit handelt es sich nicht um eine Steuerhinterziehung als Straftat. Anders als die Steuerhinterziehung, die mit einer Freiheits- oder mit Geldstrafe bestraft wird, kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR geahndet werden. Die Geldbuße hat den Sinn und Zweck, den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, zu übersteigen.
Wer kann die Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung nutzen?
Eine Selbstanzeige kann stellen, wer eine Steuerhinterziehung vollendet oder versucht hat und in die Steuerlegalität noch vor potenzieller Tatentdeckung zurückzukehren möchte. Richtig ausgeführt hat eine strafbefreiende Selbstanzeige zur Folge, dass lediglich die Steuern nebst Zinsen nachgezahlt werden müssen. Eine juristische Strafe wird dagegen nicht verhängt. Wer Steuerhinterziehung melden will und den Weg in die Steuerehrlichkeit sucht, sollte unbedingt Expertenrat hinzuziehen. Bei nachträglich gemeldeten Steuerschulden drohen zahlreiche Fallstricke, die bei Unwissen oder Fahrlässigkeit dem Steuerreuigen teuer zu stehen kommen können.
Seit Januar 2015 gelten dabei neue, verschärfte Regeln: Steuersünder bleiben jetzt nur noch straffrei, wenn sie maximal 25.000 Euro hinterzogen haben. Bei höheren Summen sieht das Gesetz teils beträchtliche Zuschläge:
- bei über 25.000 Euro zehn Prozent
- bei über 100.000 Euro 15 Prozent
- bei über 1.000.000 Euro 20 Prozent.
Vor der Novelle waren es noch fünf Prozent bei einem Hinterziehungsbetrag von über 50.000 Euro. Die Selbstanzeige wirkt auch nur dann strafbefreiend, wenn sie die Einkünfte für die vergangenen zehn Jahre umfasst und nicht, wie in der Vergangenheit, fünf Jahre. Werden formale Fehler bei der Abgabe der Selbstanzeige gemacht, verliert sie ihre strafbefreiende Wirkung und der Betroffene wird wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich belangt.
Für welche Steuerstraftaten ist eine Selbstanzeige möglich?
Die Selbstanzeige ist nur bei der Steuerhinterziehung nach § 370 AO möglich. Eine Selbstanzeige muss zwingend alle unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart betreffen. Dabei muss der Steuersünder:
- die unrichtigen Angaben in vollem Umfang berichtigen,
- die unvollständigen Angaben ergänzen
- die unterlassenen Angaben nachholen.
Das gilt sowohl für versuchte Steuerhinterziehungen als auch für vollendete Delikte. Straffreiheit wird nur gewährt, wenn alle drei Punkte vollständig erfüllt sind. Eine unvollständige oder fehlerhafte Selbstanzeige führt zu keinem Straferlass, allerdings bezieht sich dies immer nur auf eine Steuerart. Der Betroffene kann also für die hinterzogene Einkommenssteuer eine strafbefreiende Selbstanzeige abgeben, die ebenfalls hinterzogene Schenkungssteuer aber verschweigen. Entdeckt das Finanzamt den Steuerbetrug in Sachen Schenkungssteuer, wird auch nur diese Straftat verfolgt.
Für andere, etwa besonders schwere Fälle der Steuerhinterziehung greift eine Selbstanzeige nicht. Als schwere Fälle gelten beispielsweise:
- Steuerverkürzungen bzw. nicht gerechtfertigte Steuervorteile in großem Ausmaß,
- Amtsmissbrauch und Mithilfe beim Amtsmissbrauch,
- Verwendung nachgemachter oder gefälschter Belege, die fortgesetzt zu Steuerverkürzungen oder nicht gerechtfertigten Steuervorteilen geführt haben
- organisierte Steuerkriminalität
Auch andere Delikte, die häufig mit Steuerhinterziehung einhergehen, bleiben von der strafbefreienden Wirkung der Selbstanzeige unberührt. Dazu gehören Korruption, BaFöG-Betrug, Urkundenfälschung, Geldwäsche oder Untreue.
Was setzt eine strafbefreiende Selbstanzeige voraus?
Bei einer strafbefreienden Selbstanzeige müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
- Ordnungsgemäßer Versand
- Vollständige Angaben: die Angaben müssen so konkret sein, dass das Finanzamt die Steuer ohne längere eigene Ermittlungen sofort festsetzen kann. (§ 371 Abs. 1, 2a AO)
- Verjährungsregelungen: Die Angaben müssen innerhalb der relevanten Verjährungsfristen gemacht werden
- Nachzahlung von Steuern und Zinsen: Die Steuern müssen vollständig innerhalb bestimmter – meist sehr eng bemessenen – Fristen nachbezahlt werden (§ 371 Abs. 3 AO)
- Kein Ausschluss: Die Tat darf zum Zeitpunkt der Selbstanzeige noch nicht entdeckt worden sein und es ist kein besonders schwerer Fall (§ 371 Abs. 2 AO)
Mit welcher Strafminderung kann man bei Steuerhinterziehung durch eine Selbstanzeige rechnen?
Eine wirksame Selbstanzeige hat keine Strafminderung zur Folge. Hat der Betroffene die gesetzlichen Voraussetzungen der Selbstanzeige beachtet, kommt es zu keiner Bestrafung.
Ist eine Selbstanzeige hingegen fehlerhaft oder unvollständig, führt diese nicht zur Strafbefreiung.
Erlangt man durch eine Selbstanzeige automatisch Straffreiheit?
Die Abgabe einer Selbstanzeige darf nie überstürzt erfolgen, denn mit jedem, noch so kleinen Fehler bringen sich die Betroffenen selbst um die Strafbefreiung. Nachträgliche Korrekturen sind nicht erlaubt. Eine weitreichende Konsequenz kann eine misslungene Selbstanzeige sein und eine Strafe nach sich ziehen. Ohne Steuerexperten und Anwalt für Steuerrecht ist eine Selbstanzeige also äußerst riskant. Das sind die größten Risiken:
- Risiko Nr. 1: Der eigene Steuerberater
Wer sich zur Selbstanzeige entschließt und seinen Steuerberater einschaltet, kann keinen Rückzieher mehr machen. Laut Gesetz ist ein Steuerberater nämlich dazu verpflichtet, die Steuern richtig zu erklären. Wenn er von einer Steuerhinterziehung oder einem Schwarzgeld-Konto erfährt, muss er das anzeigen. Sonst kann er sich teilschuldig machen. - Risiko Nr. 2: Der Zeitpunkt
Auf eine mögliche Freisprechung kann der Steuersünder nur dann hoffen, wenn die Steuerfahndung den Tatbestand noch nicht kennt. Eine Selbstanzeige kommt zu spät, wenn eine Prüfungsanordnung der Finanzbehörde oder die Mitteilung über die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bereits ins Haus geflattert ist. - Risiko Nr. 3: Die Vollständigkeit
Der Steuerzahler muss bei einer Selbstanzeige alles sehr gewissenhaft und lückenlos offenbaren. Alle Einkünfte müssen vollständig und korrekt erfasst sein, alle Steuerarten, die Höhe der Steuerschulden, die Zinsen sowie die Herkunft des Geldes gehören dazu. Halbherzige oder fehlerhafte Selbstanzeigen ziehen meist eine Betriebsprüfung und umfangreiche Steuerstrafverfahren nach sich, das Finanzamt prüft nämlich ganz genau, ob die Selbstanzeige umfassend und vollständig ist. Entdeckt der Fiskus unangemeldete Schwarzgeld-Konten oder andere Unregelmäßigkeiten, greift die Straffreiheit nicht mehr. - Risiko Nr. 4: Die Nachzahlung
Bei einer Selbstanzeige wird die Nachzahlung entweder sofort oder innerhalb von sehr eng bemessenen Fristen fällig. Wer die Schulden nicht fristgemäß bezahlt, verspielt seine Chance auf Straffreiheit. Manche Steuerrechtsexperten empfehlen eine Überweisung sogar direkt bei der Selbstanzeige, am besten mit einem Sicherheitsaufschlag von 15 bis 30 Prozent. Das schützt vor bösen Konsequenzen, falls sich Rechenfehler eingeschlichen haben sollten. Das zu viel Bezahlte wird erstattet. Wenn es jedoch zu wenig war, ist die Straffreiheit in Gefahr. Eine Selbstanzeige ist also nur dann sinnvoll, wenn ausreichend Geldmittel zur Verfügung stehen. Dabei sollen auch die Hinterziehungszinsen berücksichtigt werden, die mit 6 % jährlich bei längeren Zeiträumen spürbar zu Buche fallen. - Risiko Nr. 5: Die Verjährungsfrist
Steuerschulden verjähren theoretisch nach zehn Jahren, steuerlich relevant ist allerdings nicht nur die letzte Dekade. Gemäß Paragraf 171 Abs. 1 Nr. 1 AO können Einkünfte nämlich innerhalb von drei Jahren erklärt werden, die die Verjährungsfrist beginnt also erst nach Ablauf dieser drei Jahre. Damit ist eine Steuerhinterziehung faktisch erst nach dreizehn Jahren verjährt. - Risiko Nr. 6: Die Beihilfe
Eigene Steuerhinterziehung kann sehr schnell auch größere Kreise betreffen. Denn die Finanzbeamten wollen nicht nur Zinseinnahmen und Kapitalhöhe wissen, sondern auch die Geldquelle kennen. Erwähnt der Betroffene Geschenke aus dem Familienkreis, zwingt er auch seine Wohltäter zur Steuerehrlichkeit. Alles, was in der Selbstanzeige an neuen Beweisen zu weiteren Steuerschulden aufkommt, darf der Finanzbeamte für die Steuerfahndung verwenden.
Was bedeutet eine Strafanzeige für den Steuerberater?
Kommt ein Neumandant zum Steuerberater mit der Bitte eine Selbstanzeige einzureichen, muss der Steuerberater das Mandat nicht annehmen. Er kann das Mandat ablehnen. „Allerdings muss er dies unverzüglich – ohne schuldhaftes Zögern – tun“, erklärt Ronald Haffner, ein Berliner Steuerberater. „In der Praxis erfolgt die Ablehnung gleich im Erstkontakt, egal ob telefonisch, persönlich oder per E-Mail“. Handelt es sich aber um ein bereits länger bestehendes Dauermandat und der Steuerberater hat in den Jahren, wo Steuern hinterzogenen wurden, an den Steuererklärungen mitgewirkt, ist er faktisch in die Steuerhinterziehung involviert und wird die Selbstanzeige einreichen. „Gleichwohl wird im Regelfall die Staatsanwaltschaft prüfen, ob das Ermittlungserfahren auch auf den Steuerberater wegen eines „Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung“ erweitert wird“, so der Berliner Steuerexperte. „Der Steuerberater wird in den meisten Fällen nach Einreichung der Selbstanzeige vorsorglich das Mandat niederlegen, obgleich er dazu nicht gesetzlich verpflichtet ist“
Wann ist eine Selbstanzeige beim Finanzamt nicht mehr möglich?
Unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Selbstanzeige nicht mehr möglich bzw. deren strafbefreiende Wirkung ist nicht mehr gegeben. Im Einzelnen regelt das der Paragraf 371 Abs. 2 der Abgabenordnung. Insbesondere bei bereits erfolgten Tatentdeckung oder bei höheren Hinterziehungsbeträgen ist die Möglichkeit ausgeschlossen, mit der Selbstanzeige Straffreiheit zu erlangen. „Eine Selbstanzeige ist nicht mehr möglich, wenn die Finanzverwaltung bereits Kenntnis von der Steuerhinterziehung hat„, erklärt Ronald Haffner. „‚Kenntnis haben‘ bedeutet vor allem, dass die entsprechenden Nachweise, Belege, Dokumente oder auch mündliche Aussagen zumindest einem Beamten bekannt gemacht wurden oder in Form einer E-Mail, eines Postbriefes oder auch z.B. einer externen Festplatte mit PDF-Dokumenten sich im Verantwortungsbereich der Finanzverwaltung befinden.“
Folgende Sperrgründe schließen eine strafbefreiende Selbstanzeige aus:
- die Steuerbehörde hat bereits eine Prüfungsanordnung verschickt
- ein Straf- oder Bußgeldverfahren ist bereits eingeleitet worden
- ein Steuerbeamter ist beim Betroffenen bereits erschienen
- einer der Steuerstraftaten ist bereits entdeckt worden und der Steuersünder musste damit rechen
- die hinterzogene Steuer übersteigt 25.000 Euro je Tat (§ 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 bis 5)
Ist eine Selbstanzeige noch möglich, wenn man vom Finanzamt zur Abgabe der Steuererklärung aufgefordert wurde?
Haben Sie noch keine Steuererklärung abgegeben, wurden dazu aber vom Finanzamt aufgefordert, müssen Sie ihm Folge leisten. In dem Fall können Sie rechtzeitig all Ihre Einkünfte offenbaren. Eine Selbstanzeige ist nur dann sinnvoll, wenn Sie Ihre Steuererklärung bereits abgegeben haben und eine Nacherklärung einreichen möchten. Soll Ihnen allerdings nicht möglich sein, die reguläre Steuererklärung innerhalb der vorgegebenen Frist abzugeben, müssen Sie rechtzeitig einen Antrag auf Fristverlängerung stellen. Sonst können Sie mit einem Verspätungszuschlag bestraft werden.
Beeinflussen Steuer-CDs die Wirksamkeit einer Selbstanzeige?
Die Angst vor den berühmt-berüchtigten Steuer-CD aus der Schweiz ist berechtigt nicht nur dann, wenn dort der eigene Name tatsächlich erscheint. Schon die medienwirksame Existenz der Datensätze kann eine strafbefreiende Selbstanzeige unmöglich machen – je nach dem, wie das unbestimmt formulierte Gesetz von den Finanzbehörden auch interpretiert wird. Laut der Abgabenordnung hat eine Selbstanzeige nämlich unter anderem dann keine strafbefreiende Wirkung mehr, wenn der Steuersünder damit rechnen müsste, dass die Steuerhinterziehung auch entdeckt ist.

Ob eine Steuerstraftat als entdeckt gilt, wenn eine Steuer-CD mit dem Namen des Betroffenen darauf angekauft und in der Presse darüber berichtet wurde, ist umstritten. Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen schließt eine strafbefreiende Selbstanzeige nach dem Ankauf einer Steuer-CD und anschließender Berichterstattung in den Medien nicht aus. Allerdings ist die Meinung aus NRW nicht verbindlich für die anderen Bundesländer: Jede Finanzbehörde kann nach eigenem Ermessen handeln.
Experten erwarten, dass die Steuerfahnder unter dem Erfolgsdruck bei der Aufdeckung unbekannter Steuerfälle und Erschließung neuer Geldquellen für den Fiskus eher zu einer strengen Interpretation des Gesetzes neigen. In der Regel führen sie dann den Zeitpunkt an, zu dem erstmals konkrete Presseberichte über den Ankauf von Steuer-CDs mit namentlicher Nennung des betroffenen Kreditinstitutes veröffentlicht wurden. Letztendlich liegt die Interpretationshoheit bei der Rechtsprechung, die bis jetzt jedoch noch keine Überprüfung dieser Gesetzesauslegung durch die Finanzverwaltung vorgenommen hat.
Ist eine Selbstanzeige bei einer Lohnsteuer-Nachschau noch möglich?
Die sogenannte Lohnsteuer-Nachschau, geregelt durch den Paragraf 42g des Einkommensteuergesetzes, soll eine ordnungsgemäße Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer sicherstellen und dient zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte. Bei einer LST-Nachschau kann der Betriebsprüfer ohne Vorankündigung vor Ort auftauchen und die entsprechenden Unterlagen verlangen. Entdeckt er hierbei Unregelmäßigkeiten, die als Steuerhinterziehung entlarvt werden, so gilt diese Tat als entdeckt und eine Selbstanzeige ist nicht mehr möglich.
Wie macht man eine Selbstanzeige bezüglich Steuerhinterziehung?
Wer eine Selbstanzeige erstattet will, muss sich eigentlich nur eine Tatsache merken: Ohne einen anwaltlichen Rat ist die reuige Offenbarung vor dem Finanzamt oftmals ein Ritt ins Verderben. Wer auf eigene Faust agiert, setzt nicht nur die mögliche Straffreiheit aufs Spiel, die er mittels wirksamer Selbstanzeige erlangen könnte. Er deckt aus Unwissenheit auch Mittäter auf. Wie macht man eine Selbstanzeige? Gemeinsam mit einem Experten!
An wen muss die Selbstanzeige Steuerhinterziehung gerichtet werden?
Die Selbstanzeige soll immer an das örtliche Finanzamt des Steuersünders verschickt werden. Wer sich an die Staatsanwaltschaft oder Polizei wendet, verliert unwiderruflich die Möglichkeit der Straffreiheit. Die Polizei leitet die Selbstanzeige weiter an die Staatsanwaltschaft, und die Staatsanwaltschaft verfolgt andere Interessen als das Finanzamt.
Was muss bei einer strafbefreienden Selbstanzeige angegeben werden?
Das Gesetz sieht für die Selbstanzeige keine bestimmte Form vor. Doch auch, wenn sie formlos sein darf, müssen Sie lückenlos alle Angaben zu noch nicht verjährten Steuerstraftaten der betreffenden Steuerart – beispielsweise der Einkommenssteuer – offenlegen, die Sie in der letzten Dekade begangen haben. Wird eine vergessen, tritt die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige nicht ein. Da Sie bei einer Selbstanzeige damit rechnen müssen, dass der Fiskus misstrauisch wird und weitere Nachforschungen anstellt, stellt sich auch die Frage, ob nicht gleich auch besser wäre, eine Steuerhinterziehung aus anderen Steuerarten – falls erfolgt – angegeben werden sollte.
Für welchen Zeitraum muss ich bei einer Selbstanzeige Steuererklärungen erstellen?
Seit dem 1.1.2015 müssen die Steuersünder bei einer Selbstanzeige gleich drei Fristen beachten:
- die steuerliche Festsetzungsverjährung: zehn Jahre plus bis zu drei Jahre (§ 169 II 2 und § 170 AO)
- die strafrechtliche Verfolgungsverjährung von fünf Jahren im Regelfall oder zehn Jahren bei besonders schweren Fällen)
- den zehnjährigen Berichtigungszeitraum nach (§ 371 I 2 AO).
Diese strafrechtlichen Verjährungsfristen sind bei der Fertigung der Selbstanzeige unbedingt zu berücksichtigen: Die Wirksamkeit der Selbstanzeige hängt von der Einhaltung der jeweils längeren Frist ab: zehn Jahre mindestens oder ggf. längere strafrechtliche Verfolgungsverjährung.
Was passiert nach einer Selbstanzeige beim Finanzamt?
Landet eine Selbstanzeige beim Finanzamt, wird ein Ermittlungsverfahren durch die Bußgeld- und Strafsachenstelle eröffnet. Es dient dazu, zu überprüfen, ob die Angaben bei der Anzeige alle Voraussetzungen für eine Strafbefreiung erfüllen. „Die Steuerfahndung – vergleichbar mit der Kriminalpolizei – prüft, ob der Sachverhalt durch die Selbstanzeige hinreichend aufgeklärt ist, oder ob weiter tiefer ermittelt werden muss“, erläutert Ronald Haffner, Geschäftsführer der Summacom Steuerberatungsgesellschaft. „Die Staatsanwaltschaft prüft, ob ein formelles staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren mit Anklage vor einem Strafgericht eröffnet werden muss, oder ob ein Bußgeld durch die Bußgeldstelle ausreicht.“ Stellt die Prüfung fest, dass die Anzeige wirksam ist, wird das Strafverfahren sofort eingestellt. Vor Einleitung des Strafverfahrens kann es auch passieren, dass das Finanzamt weitere Informationen und Unterlagen einfordert, die für die Prüfung erforderlich sind. Über die Wirksamkeit der Selbstanzeige werden Steuersünder schriftlich informiert. Danach ist eine Bestrafung wegen Steuerhinterziehung nicht mehr möglich.
Wann verjährt Steuerhinterziehung?
Steuerbetrug kann strafrechtlich und steuerlich geahndet werden. Strafrechtlich kann Steuerhinterziehung fünf Jahre rückwirkend bestraft werden, ausgehend von dem Tag, an dem der Steuerbescheid mit der zu niedrigen Steuer empfangen wurde. Steuerrechtlich gilt die sogenannte Festsetzungsfrist, die bei Steuerhinterziehung zehn Jahre und bei Steuerverkürzung fünf Jahre beträgt. Erst wenn beide Fristen abgelaufen sind, können Steuersünder nicht mehr belangt werden.